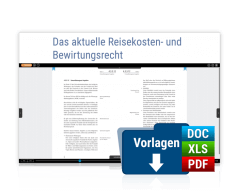Inhaltsverzeichnis
- Versteuerung eines E-Autos als Dienstwagen
- Elektroauto privat nutzen
- Gesetzliche Förderung: Vorteile durch Umweltprämie
- E-Bike als Dienstwagen
Versteuerung eines E-Autos als Dienstwagen
Kommt ein E-Auto als Firmenwagen in Frage, kann der Arbeitgeber verschiedene steuerrechtliche Maßnahmen treffen, um den Einsatz solcher Fahrzeuge zu unterstützen und steuerliche Vorteile zu erzielen. Ein aktuelles BMF-Schreiben vom 03.03.2022 zeigt, welche steuerrechtlichen Regelungen zu E-Autos als Firmenwagen Arbeitgeber beachten müssen.
Pauschalisierung der Lohnsteuer um 0,25
Eine Möglichkeit für Arbeitgeber besteht darin, die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 25 % zu erheben (0,25-Regelung). Diese Methode gilt für geldwerte Vorteile aus der Übereignung einer Ladevorrichtung und für Arbeitnehmerzuschüsse für den Erwerb und die Nutzung einer Ladevorrichtung nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 EStG.
Allerdings ist diese 0,25-Regelung nur erlaubt, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zusätzlich zum Arbeitslohn günstiger oder kostenfrei eine Ladestation übereignet. Als Bemessungsgrundlage kann er die Aufwendungen für den Erwerb der Ladestation zugrunde legen. Kauft der Arbeitnehmer selbst eine Ladestation, kann der Arbeitgeber diese bezuschussen und die Lohnsteuer nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 EStG pauschal ebenfalls mit 25 % erheben.
Nutzt der Arbeitnehmer sein privates Elektroauto für Dienstfahrten, kann er anstelle der tatsächlich anfallenden Kosten die gesetzlich festgelegten pauschalen Kilometersätze gemäß § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 2 EStG auch dann nutzen, wenn er steuerfreie Vorteile oder pauschal besteuerte Leistungen und Zuschüsse vom Arbeitgeber erhält.
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, bei der pauschalen Lohnsteuererhebung die steuerfreien Vorteile (Aufwendungen des Arbeitgebers für den Erwerb der Ladevorrichtungen, Zuschüsse, bezuschusste Arbeitnehmeraufwendungen) im Lohnkonto des Arbeitnehmers zu dokumentieren.
Andere Vorgaben zur Versteuerung gelten bei einer Privatnutzung von Elektroautos, wenn sie ursprünglich als reines Firmenfahrzeug genutzt wurden.
Elektroauto privat nutzen
Will ein Arbeitnehmer sein E-Auto, das als Firmenwagen fungiert, auch für private Zwecke nutzen, müssen sowohl er als auch der Arbeitgeber einige Punkte beachten. Der folgende Abschnitt zeigt die wichtigsten Punkte auf.
Privatnutzung als geldwerter Vorteil
Nutzt ein Arbeitnehmer den Firmenwagen privat, liegt gemäß § 8 Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) ebenfalls ein geldwerter Vorteil beim Arbeitnehmer vor. Diesen muss der Arbeitgeber im Rahmen der Gehaltsabrechnung zusätzlich versteuern.
Die Höhe des geldwerten Vorteils bemisst sich dabei nach dem Nutzungswert. Er lässt sich nach einer der beiden folgenden Methoden ermitteln:
| Methode | Erklärung |
| 1%-Regelung | Bei dieser pauschalen Nutzungswertermittlung gilt 1 % des Bruttolistenpreises des genutzten Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Erstzulassung monatlich als geldwerter Vorteil. Dieser Anteil muss als Einnahme (des Arbeitnehmers) versteuert werden. Einzelnachweise sind nicht notwendig. |
| Fahrtenbuchmethode oder Einzelnachweis | Für diese Methode muss der Beschäftigte akribisch und lückenlos ein eigenes Fahrtenbuch führen. Damit wird das Verhältnis zwischen betrieblichen und privaten Fahrten ermittelt. Auf dessen Grundlage ermittelt der Arbeitgeber kilometergenau, wie hoch der private Nutzungsanteil für den Dienstwagen ist. Anschließend versteuert er diesen Betrag. Die Herausforderung bei dieser Methode: Das zuständige Finanzamt stellt oft sehr hohe Anforderungen, wie der Arbeitnehmer das Fahrtenbuch ordnungsgemäß zu führen hat. Erfüllt er diese Anforderungen nicht, wird die Versteuerung anhand der 1%-Regelung vorgenommen. |
Wie Arbeitgeber die o. g. Methoden bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung fachgerecht anwenden, zeigen die Tipps und Rechenbeispiele des digitalen Handbuchs „Das aktuelle Reisekosten- und Bewirtungsrecht“. Es bietet einen Überblick über alle wichtigen Regelungen zur allgemeinen Firmenwagenbesteuerung, aber auch zu Besonderheiten bei der Versteuerung von E-Autos oder Privatnutzung durch den Arbeitnehmer.
Gesetzliche Förderung: Vorteile durch Umweltprämie
Um die Nutzung von E-Autos als Firmenwägen zu fördern, verabschiedete der Gesetzgeber bereits verschiedenste Förderprogramme. Ein Meilenstein bildet das Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität im Straßenverkehr. Es trat bereits im November 2016 in Kraft und ermöglichte mit einem weiteren BMF-Schreiben vom 14.12.2016 steuerliche Vorteile für den Ausbau der Ladeinfrastruktur.
Grundlegender Bestandteil dieser Regelungen ist ein Umweltbonus bzw. eine Umweltprämie, die seit dem 01.01.2017 gilt. Ursprünglich hätte diese Fördermaßnahme am 31.12.2020 auslaufen sollen. Allerdings wurde die Prämie im Februar 2020 bis Ende 2025 verlängert. Sie betrifft rückwirkend alle Fahrzeuge, die vom 05.11.2019 bis zum 31.12.2025 zugelassen werden.
Ansprechpartner für die Beantragung der Kaufprämie ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).
Firmenwagen E-Auto zu Hausen laden: Wann greift die Förderung?
Mit dem Gesetz wird das elektrische Aufladen von Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen gemäß § 3 Nr. 46 EStG von der Einkommensteuer befreit. Die Erleichterung gilt für zusätzlich zum Arbeitslohn gewährten Vorteile, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
- Das Hybrid- und Elektrofahrzeug i. S. d. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 2. Halbsatz EStG wird an einer ortsfesten betrieblichen Ladestation des Arbeitgebers oder eines verbundenen Unternehmens aufgeladen.
- Das E-Auto wird im Zuhause des Arbeitnehmers aufgeladen. In jedem Fall an einer betrieblichen Ladevorrichtung, die der Arbeitgeber dem Beschäftigten zur Privatnutzung überlassen hat.
- Ein Leiharbeitnehmer im Betrieb des Entleihers bezieht den Ladestrom.
Die Steuerbefreiung greift in diesen Fällen nicht:
- Das Elektrofahrzeug wird von Geschäftsfreunden des Arbeitgebers aufgeladen.
- Kunden des Arbeitgebers laden ihre Elektrofahrzeuge an der Ladestation auf.
Begünstigt wird das Aufladen sowohl von privaten Elektrofahrzeugen als auch von betrieblichen E-Autos, die dem Arbeitnehmer zur privaten Nutzung überlassen wurden.
Wird dabei der geldwerte Vorteil aus der privaten Nutzung nach der 1%-Regelung bei Elektroautos ermittelt, ist er für den Ladestrom, der vom Arbeitgeber verbilligt oder kostenlos gestellt wurde, bereits abgegolten. Nutzen Arbeitgeber und Mitarbeiter zur Ermittlung die Fahrtenbuchmethode, bleiben die Kosten für den steuerfreien Ladestrom für die Ermittlung der Gesamtkosten des Fahrzeugs außer Ansatz.
Die Steuerbefreiung ist weder auf einen Höchstbetrag noch auf eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen begrenzt.
Welche Fahrzeuge werden gefördert?
| Elektrofahrzeuge | Hybridelektrofahrzeuge |
| = Ein Kraftfahrzeug, das ausschließlich durch einen Elektromotor angetrieben wird. Dieser Elektromotor muss ganz oder überwiegend von einem mechanischen oder elektromechanischen Energiespeicher oder aus emissionsfrei betriebenen Energiewandlern gespeist werden. | = Ein Hybridfahrzeug, das aus einem Betriebskraftstoff oder einer Speichereinrichtung für elektrische Energie/Leistung gespeicherte Energie oder Leistung bezieht. Im Sinne dieser Vorschrift müssen Hybridelektrofahrzeuge extern aufgeladen werden können. |
Tipp: Passende Arbeitshilfen und Berechnungsbeispiele zur Privatnutzung von E-Autos als Firmenfahrzeug bietet das Handbuch „Das aktuelle Reisekosten- und Bewirtungsrecht“.
E-Bike als Dienstwagen
Zu den begünstigten Fahrzeugen zählen auch Elektrofahrräder, wenn diese nach dem Straßenverkehrsgesetz (StVG) als Kraftfahrzeug eingeordnet werden. E-Bikes, die nicht als Kraftfahrzeuge gelten, weil für sie keine Kennzeichen- und Versicherungspflicht besteht, werden nicht steuerlich begünstigt.
Das bedeutet: Für die Ermittlung des geldwerten Vorteils muss der Arbeitgeber die allgemeinen Regelungen zur Pkw-Besteuerung anwenden. Neben der 1%-Regelung bei Elektroautos beinhaltet das auch die Berechnung mit 0,03 % des Bruttolistenpreises für Fahrten zur Arbeitsstätte (0,03%-Regelung). Es kann aber auch die Fahrtenbuchmethode angewendet werden.
Für die private Nutzung von Dienstfahrrädern ist ebenfalls die Besteuerung nach der 1%-Regelung vorgesehen. Damit kann der Arbeitgeber vom Listenneupreis des Fahrrads pro Monat 1 % als geldwerter Vorteil durch den Arbeitnehmer versteuern. Eine Versteuerung für Fahrten zwischen der Wohnung und der Arbeitsstätte ist allerdings nicht möglich.
Schließt der Arbeitgeber mit einem Dienstleister einen Rahmenvertrag ab, mit dem ein Leasingvertrag über die Fahrräder geschlossen wird, gelten weitere Regelungen bzgl. der lohnsteuerlichen Behandlung. Hilfreiche Handlungsempfehlungen hierzu bietet das Werk „Das aktuelle Reisekosten- und Bewirtungsrecht“.
Quellen: „Das aktuelle Reisekosten- und Bewirtungsrecht“, bundesfinanzministerium.de